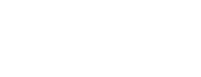I Confidenti feierte mit „La Mara – Die Primadonna“ eine bejubelte Premiere im Schlosstheater
„Der König saß auf dem Sofa nebst den Generalen und seinen drei italienischen Windhunden, welche ein lautes Bellen anfingen, als sie eine weibliche Figur erblickten.“ So begann das Vorsingen von Gertrud Elisabeth Schmeling vor Friedrich II. Legendär wurde die Szene, die von ihr selbst höchst amüsant in ihrer Autobiografie beschrieben wird, vor allem weil es ihr gelang, mit ihrem Gesang den störrischen Widerstand von Friedrich II. gegen deutsche Sänger zu überwinden. Den Gesang von Kastraten behielt der König jedoch auf der Berliner Oper bis zuletzt bei. Aber Gertrud Elisabeth Schmeling wurde immerhin die erste deutsche Sängerin an der Königlichen Hofoper in Berlin.
Nach ihrem knapp achtjährigen Engagement reüssierte sie als Primadonna auf den berühmtesten Bühnen Europas. Auf dem Schauplatz, wo die Zweiundzwanzigjährige einst ihr preußisches Debüt gab, im Schlosstheater im Neuen Palais in Sanssouci, feierte nun das Potsdamer Ensemble I Confidenti mit der szenisch-konzertanten Aufführung von „La Mara – Die Primadonna“ eine bejubelte Premiere. Unter der Regie von Nils Niemann, der musikalischen Leitung von Irmgard Huntgeburth und der farbenprächtigen Ausstattung von Christine Jaschinsky erstand das Leben der Mara in vielen kleinen Szenen voller Witz und Virtuosität wieder auf. Nicht zuletzt die vier Darsteller, Sopranistin Doerthe Maria Sandmann, Sopranist Philipp Mathmann, Pantomime Steffen Findeisen und Erzähler Klaus Büstrin setzten der stark komprimierten Aufführung szenische und musikalische Glanzlichter auf.
Zu ihrer Zeit übertraf der Ruhm von La Mara, wie sie nach ihrer Heirat mit dem Cellisten und Sänger Johann Mara hieß, den von Johann Wolfgang von Goethe bei Weitem. Mit Goethe teilt sie nicht nur das Geburtsjahr, sondern beinahe auch das Todesjahr. Schon als junger Student widmete Goethe ihr ein Gedicht und noch im Alter von 81 Jahren reimte er für sie: „Sangreich war dein Ehrenweg/ jede Brust erweiternd“.
Klaus Büstrin gab nicht nur einen sonoren Vorleser, sondern deklamierte auch diese von Johann Nepomuk Hummel vertonte Eloge sangreich zum Finale. Abgesehen von diesem Ausflug in die Romantik bewegte sich der musikalische Teil überwiegend im Umfeld der Opera seria und förderte dabei allerlei Klangvolles, Seltenes und Unbekanntes zu Tage. Auch kleine Instrumentalstücke aus dem zeitgenössischen Umfeld der Mara erklangen, etwa für Violine, Cello und Flöte, passend zu den jeweiligen Szenen. Bei einem elegischen Cello-Solo und den autobiografischen Worten „Er war doch der schönste Mann“ konnte man sich die Gefühle der Mara für ihren ersten Ehemann vorstellen, der vom Liebling des Prinzen Heinrich zum Ehemann der Mara mutierte, bis er als Trunkenbold endete. Dennoch unterstütze ihn seine Ex- Frau lebenslang.
Begonnen hatte die Mara als Geige spielendes Wunderkind, bevor ihr Gesangstalent von Johann Adam Hiller in Leipzig gefördert wurde. Noch als junger Teenager reiste sie mit ihrem Vater durch England, allerdings recht erfolglos, sodass Konzert und Schuldhaft einander abwechselten. Nicht zuletzt die Tatsache, dass die Mara eine unverblümte Sprache kultivierte und selbst vor Königlichen Hoheiten nicht klein beigab, verhinderte das Abgleiten der Inszenierung in lobselige Schmusetöne. Obwohl der preußische Dienst „sehr commode“ war und außerdem gut bezahlt, versuchte sie mehrfach die Flucht daraus. Ihre Heirat war gegen königlichen Willen erfolgt, ihr Ehemann wurde mehrfach verhaftet und auch, wie es heißt, übel zugerichtet von preußischen Soldaten. Auf Maras Bitten um Milde antwortete der König, sie würde nicht fürs Schreiben, sondern fürs Singen bezahlt.
So stand der Gesang im Zentrum des Abends, verkörpert von der blühenden Gestalt der Sopranistin Doerthe Maria Sandmann und dem ephebischen Sopranisten Philipp Mathmann. Neben dem in vielen Rollen agierenden Steffen Findeisen machten sie auch als Komödianten eine gute Figur. Doerthe Sandmann gab sowohl den Bravourarien von Carl Heinrich Graun als auch den Adagios wunderbar bewegten, expressiven Ausdruck. Philipp Mathmann verblüffte mit glockenreiner Stimme und kühlerem Timbre. Im gefühlvollen Duett „T’amo, si“ aus Georg Friedrich Händels Oper Riccardo fanden Sandmann und Mathmann zu ausdrucksvollem Gesang zusammen.
Gesteigert wurde das theatralische Element durch das verhaltene Spiel der Gesten und Posen, die der historischen Bühnenpraxis folgten. Dass nicht zuletzt die Liebe im Leben der Mara einen Schwerpunkt hatte, trat hier auch musikalisch zutage. Denn nicht nur der Gesang, wie Goethe schrieb, auch zahlreiche Geliebte säumten ihren Weg. Einem, dem jungen Henry de Bouscaren, blieb sie bis zu ihrem Tod mit Briefen verbunden und vermachte ihm sogar ihren Nachlass. Dieser dürfte allerdings nicht besonders groß gewesen sein, teilte diese große Sängerin doch das Schicksal vieler Künstler. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie mit Gesangsunterricht in Reval, wo sie in ihrem 83. Lebensjahr starb.
Babette Kaiserkern, Potsdamer Neuste Nachrichten – 5.09.2011
Foto: A. Sommer / I Condidenti